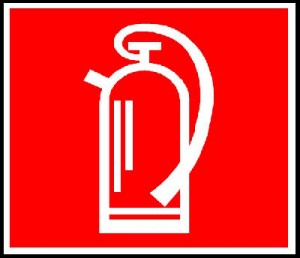 Hand-Feuerlöscher sind die Bekanntesten und wohl auch die effektivsten Kleinlöschgeräte. Abhängig von der Art des Löschmittels das in den Feuerlöscher gefüllt ist, unterscheidet man verschiedene Typen:
Hand-Feuerlöscher sind die Bekanntesten und wohl auch die effektivsten Kleinlöschgeräte. Abhängig von der Art des Löschmittels das in den Feuerlöscher gefüllt ist, unterscheidet man verschiedene Typen:
Nasslöscher (Brandklasse A)
Nasslöscher sind mit 10 Liter Wasser (fallweise wird Frostschutz zugesetzt) befüllt; Die Löschwirkung erfolgt durch die Kühlung der Brandstelle, geeignet für feste Stoffe (Holz, Papier, Stroh,…)
Schaumlöscher (Brandklasse A+B)
Schaumlöscher sind mit wässriger AFFF-Schaummittellösung befüllt (AFFF=aqueos film forming foam); diese Löscher werden zum löschen von Bränden von festen und flüssigen Stoffen wie Benzin, Petroleum, Öle, Fette, Lacke,… verwendet; die Hauptlöschwirkung ist ersticken des Feuers, Nebenlöschwirkung durch Kühlen;
Pulverlöscher (Brandklasse A+B+C*+D*)
Trockenlöscher werden nach nach Art des Löschpulvers aufgeteilt in Glutbrandpulverlöscher (Brandklasse A, B, C), in Flammbrandpulverlöscher (Brandklasse B, C) und Metallbrandpulverlöscher (Brandklasse D); eine zusätzliche Unterteilung erfolgt durch ihre Füllmengen; Die Löschwirkung erfolgt durch einen chemischen Eingriff in den Verbrennungsprozess;
Kohlendioxidlöscher (Brandklasse B+C*)
Kohlendioxidlöscher (CO2- bzw. Kohlensäurelöscher) werden meist bei Bränden an elektrischen Anlagen eingesetzt – eignen sich aber auch für Flüssigkeits- oder Gasbrände; Großer Vorteil: das Löschmittel verdunstet beinahe rückstandslos; Hauptlöschwirkung durch ersticken den Feuers;
Fettbrandlöscher (Brandklasse F)
Bei den in Fettbrandlöschern enthaltenen Löschmitteln wird durch Verseifung die brennende Flüssigkeit gelöscht und eine Sperrschicht über dem Öl oder Fett gebildet, hierdurch wird die Aufnahme von Sauerstoff unterbunden, zugleich kühlt das Löschmittel die brennende Flüssigkeit;
Brandklassen
Die Branklassen werden lt. der DIN EN 2 vom Januar 2005 in folgende 5 Klassen eingeteilt:
 Brandklasse A
Brandklasse A
Feste Stoffe (zB. Holz, Papier, Karton, Stroh,…)
 Brandklasse B
Brandklasse B
Flüssige oder flüssigwerdende Stoffe (zB. Benzin, Öle, Fette, Lacke, Alkohol,…)
 Brandklasse C
Brandklasse C
Gase (zB. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas,..)
 Brandklasse D
Brandklasse D
Metalle (zB. Aluminium, Magnesium, Lithium,…und deren Legierungen)
 Brandklasse F
Brandklasse F
Speiseöle, Speisefette und Küchengeräte
Handhabung von Feuerlöschern
Da die Bedienung der Löscher von Gerät zu Gerät verschieden ist, wird hier nur die grundlegende Anwendung erläutert.. Meist findet man am Löscher selbst eine Bedienungsanleitung (Text und Piktogramme).
Um Feuerlöscher funktionstüchtig zu halten, ist es notwendig die Löscher spätestens alle 2 Jahre überprüfen zu lassen.
Benutzte Löscher müssen, auch wenn Sie nur teilweise entleert wurden, unbedingt wieder befüllt werden.
Vorbereitung der Handfeuerlöscher vor der Brandbekämpfung
- Feuerlöscher aus der Halterung nehmen und in der Nähe des Brandherdes abstellen
- Feuerlöscher entsichern
- Druckhebel, Schlagknopf drücken bzw. Handrad der Treib-Flasche öffnen – das Zischen zeigt, dass der Löscher unter Druck (ca. 15 bar) steht; – Jetzt ist der Löscher einsatzbereit! Bei älteren Löschermodellen sind Löscher die ständig unter Druck stehen verbreitet – diese sind am angebauten Manometer erkennbar – hier fällt das Zischen weg!
- Löscher aufnehmen, Löschpistole (Austrittsöffnung) auf den Brandherd richten
Brandbekämpfung
 Feuerlöscher in Windrichtung, von vorne beginnend einsetzen
Feuerlöscher in Windrichtung, von vorne beginnend einsetzen
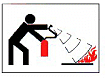 Löscher nur stoßweise betätigen
Löscher nur stoßweise betätigen
 Möglichst viele Löscher gleichzeitig einsetzen
Möglichst viele Löscher gleichzeitig einsetzen
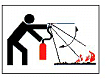 die gesamte Brandfläche abdecken
die gesamte Brandfläche abdecken
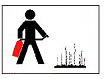 immer auf sicheren Rückzug achten
immer auf sicheren Rückzug achten
 Neuere Tunnels verfügen bereits über eine sicherheitstechnische Tunnelausrüstung, die im Notfall automatisch ablaufende Programme startet. In vielen längeren Tunnelanlagen gibt es zumindest eine Videoüberwachung, die dem Tunnelwart im Notfall hilft, das Geschehen besser einschätzen zu können. Er verständigt im Bedarfsfall auch Einsatzkräfte.
Neuere Tunnels verfügen bereits über eine sicherheitstechnische Tunnelausrüstung, die im Notfall automatisch ablaufende Programme startet. In vielen längeren Tunnelanlagen gibt es zumindest eine Videoüberwachung, die dem Tunnelwart im Notfall hilft, das Geschehen besser einschätzen zu können. Er verständigt im Bedarfsfall auch Einsatzkräfte.





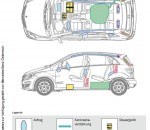








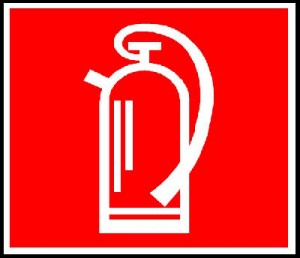






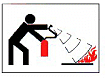

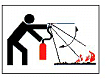
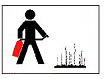


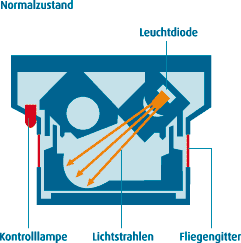
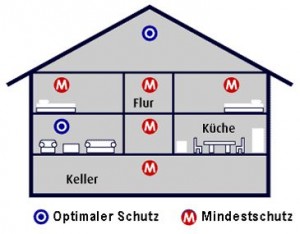



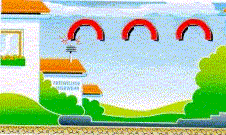
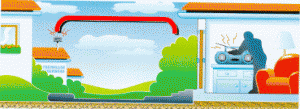



 Die Freiwillige Feuerwehr Obenberg wurde am 8. März 1931 gegründet. Seither stellten die Kameraden immer wieder Ihren Einsatzwillen, Ihren Eifer und auch Ihre Freude am Helfen unter Beweis.
Die Freiwillige Feuerwehr Obenberg wurde am 8. März 1931 gegründet. Seither stellten die Kameraden immer wieder Ihren Einsatzwillen, Ihren Eifer und auch Ihre Freude am Helfen unter Beweis.



 Der FF Obenberg gehören 141 Mitglieder an:
Der FF Obenberg gehören 141 Mitglieder an:

